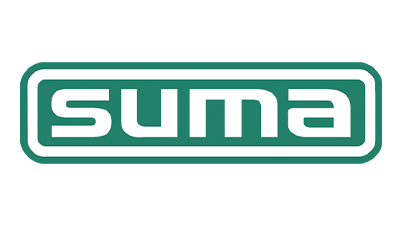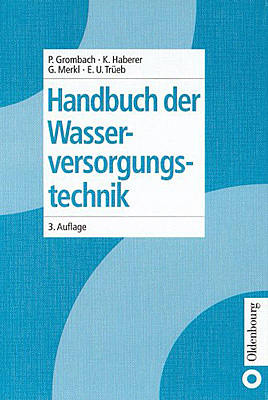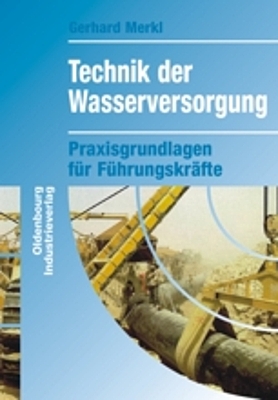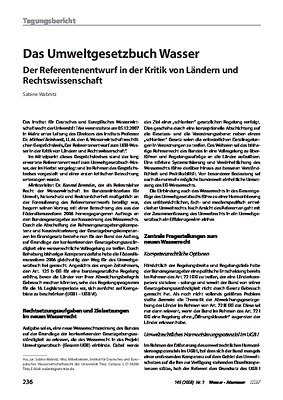Die halbtägige Veranstaltung auf der Kläranlage Wuppertal-Buchenhofen ist kostenfrei und gibt Einblicke in neue Material- und Verfahrensentwicklungen sowie unterschiedliche Einsatzfelder für Adsorptionsmaterialien in der Wasserwirtschaft.
Die drei beteiligten Forschungs- und Entwicklungsprojekte wurden im Rahmen der Fördermaßnahme MachWas vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen und ihre Ergebnisse wurden im Februar auf der MachWas-Abschlusskonferenz bei der DECHEMA in Frankfurt vorgestellt.
Im Projekt ZeroTrace wurden Aktivkohlen aus regenerativen Materialien entwickelt, die in großen Mengen preiswert verfügbar sind. Diese Aktivkohlen sollen eine Alternative darstellen zu Aktivkohle, die aus Steinkohle gewonnen wird. Darüber hinaus sollte ein Verfahren zur Regeneration der neuen Aktivkohlen am Einsatzort entwickelt werden, um den logistischen Aufwand für die Regeneration in einer zentralen Regenerationsanlage zu verhindern.
Im Projekt ContaSorb wurden Kohlenstoff-Eisen-Komposit-Materialien für die Sorption und Zerstörung von halogenierten Grundwasserschadstoffen in-situ, d.h. innerhalb des Grundwasserreservoirs, entwickelt. Neben den halogenierten Mikroschadstoffen wie Pestiziden und halogenierten Pharmareststoffen sollten auch insbesondere Lösungen zur sorptiven Anreicherung und Zerstörung von poly- und perfluorierten Tensiden gefunden werden.
Das Projekt Ferrosan adressierte Schwermetalle und Eisenverbindungen, die besonders in den Braunkohleregionen Sachsens zur Belastung der Grund- und Oberflächenwässer (sog. „Verockerung der Spree“) führen. Zur Schwermetallabscheidung und Eisenadsorption sollten hochvernetzte Biopolymere auf der Basis von Glucan-Chitin-Komplexen entwickelt werden.
Die Veranstaltungsplanung geschieht vorbehaltlich der weiteren Entwicklung in der Corona-Krise. Weitere Informationen sind demnächst auf der Webseite des Kompetenznetzwerks Umweltwirtschaft.NRW verfügbar.
Neue Adsorptionsmaterialien für die Wasserreinigung
Kategorie: Sonstiges
Themen: Abwasserbehandlung | Events | Nachhaltigkeit & Umweltschutz | Wasseraufbereitung
Autor: Jonas Völker
Das könnte Sie auch interessieren:
Passende Firmen zum Thema:
Publikationen
Sie möchten die gwf Wasser + Abwasser testen
Bestellen Sie Ihr kostenloses Probeheft
Überzeugen Sie sich selbst: Gerne senden wir Ihnen die gwf Wasser + Abwasser kostenlos und unverbindlich zur Probe!