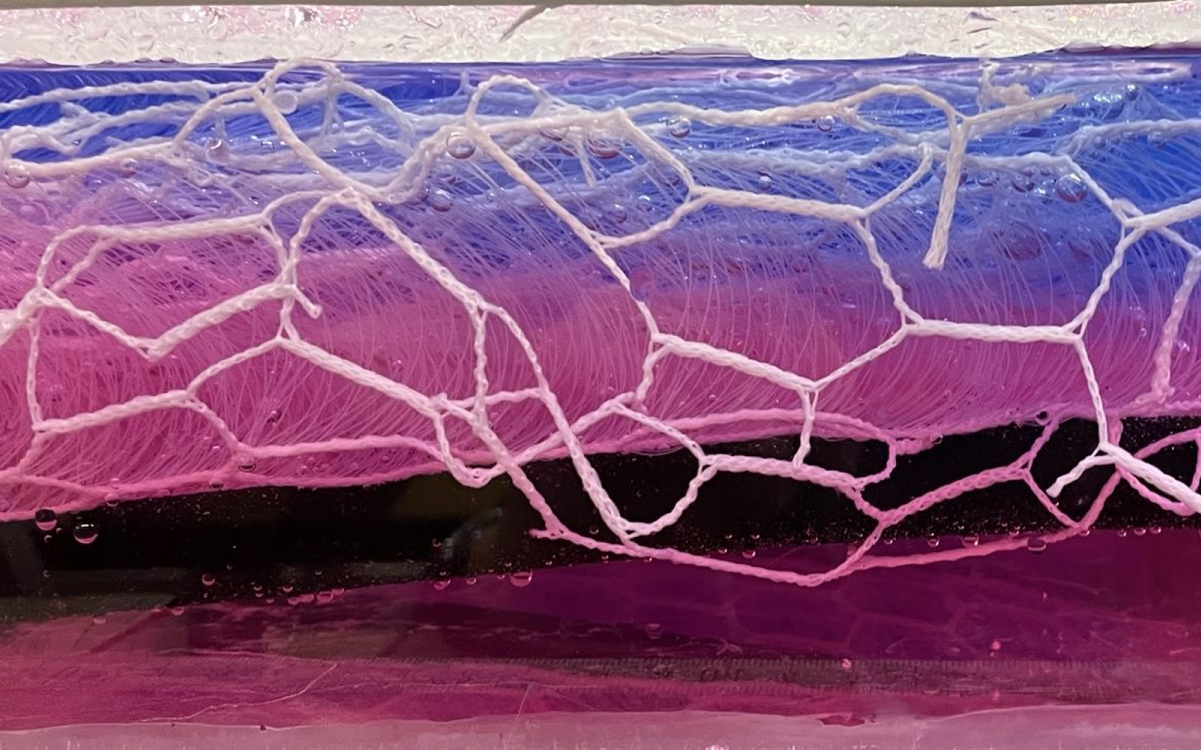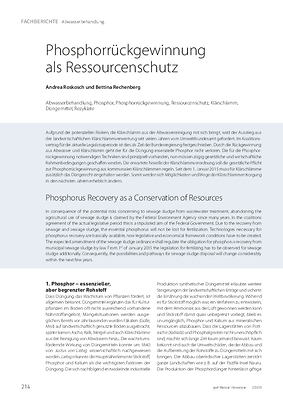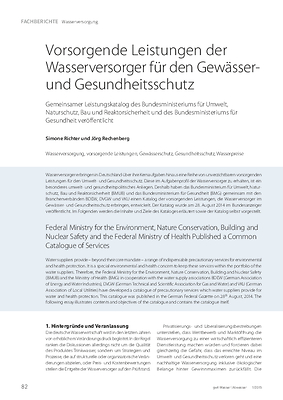27. Februar 2023 | Die Gewässernutzung kann in der Schweiz einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten. Zwei Forschende der Eawag erläutern, welche Risiken für die Gewässersysteme aus der Nutzung noch vorhandener Potentiale entstehen und wie die Konflikte zu beurteilen sind.
Herr Schmid, Sie sind Gruppenleiter in der Abteilung Oberflächengewässer der Eawag und beschäftigen sich seit Jahren mit den Auswirkungen der Wasserkraftnutzung auf die Gewässer. Der Druck, aus der Schweizer Wasserkraft noch mehr Energie zu gewinnen, ist zurzeit sehr hoch. Was hat das für Folgen für unsere Gewässer?
Martin Schmid: Die Wasserkraft hat in vielen Schweizer Fließgewässern schon zu großen Veränderungen im Vergleich zum natürlichen Zustand geführt. So ist die Lebensgrundlage von Fischen und anderen Gewässerlebewesen bereits stark beeinträchtigt.
In Restwasserstrecken fehlt ein Großteil des natürlichen Abflusses. Unnatürliche Abflussschwankungen unterhalb der Rückleitungen aus Wasserkraftwerken führen dazu, dass Organismen stranden oder abgeschwemmt werden. Stauwehre behindern die Vernetzung entlang der Gewässer. Durch den weiteren Ausbau der Wasserkraft werden die Gewässer noch stärker von solchen Auswirkungen betroffen sein.
Die Wasserkraft ist zudem nicht der einzige Faktor, der die Gewässer belastet. Verbauungen für den Hochwasserschutz, chemische Belastungen und in zunehmendem Maße auch der Klimawandel sind weitere Stressoren. Zahlreiche Arten sind aufgrund dieser Belastungen in den Schweizer Gewässern bereits ausgestorben. Von den noch verbleibenden Fischarten und den in Gewässern lebenden Insekten gelten mehr als die Hälfte als gefährdet oder potenziell gefährdet. In Anbetracht dieser Zahlen muss man sich sehr gut überlegen, ob man den Lebewesen in den Gewässern noch weitere Belastungen zumuten kann.
Restwassermengen sind essentiell
Es gibt aber etwa bei den Restwassermengen Bestrebungen, die Umsetzung der minimalen Vorgaben aus dem Gewässerschutzgesetz zu lockern, um keine Kilowattstunde zu “verlieren”. Besteht hier aus Sicht des Gewässerschutzes tatsächlich Spielraum?
Genügend Restwasser ist notwendig, damit Fische und andere Lebewesen in den Gewässern überleben und sich vermehren können. Dazu kommen andere Funktionen, welche Gewässer mit zu knapp bemessenen Restwassermengen nicht mehr erfüllen können, etwa die Speisung von Grundwasservorkommen oder ihr Nutzen als Erholungsraum für die Bevölkerung. Die Ökologie in Restwasserstrecken ist bereits heute stark beeinträchtigt und gerät durch den Klimawandel noch zusätzlich unter Druck. Aus Sicht des Gewässerschutzes ist es deshalb von großer Bedeutung, dass zumindest die gesetzlich vorgeschriebenen Restwassermengen eingehalten werden. Aus Sicht der Wissenschaft wären zudem dynamische Restwassermengen wünschenswert, deren Variabilität der natürlichen Dynamik eines Gewässers entspricht.
Eine weitere Forderung ist, bei bestehenden Stauseen die Mauern zu erhöhen und damit mehr Wasser, respektive mehr Strom vom Sommer in den Winter verlagern zu können. Ist das aus Sicht der Gewässerforschung eine gute Lösung?
Bei den meisten Schweizer Fließgewässern wird der Klimawandel dazu führen, dass der Abfluss im Winter künftig deutlich höher und im Sommer deutlich niedriger sein wird. Durch einen Ausbau der saisonalen Speicher wird dieser Effekt noch verstärkt. Es ist aber noch nicht genügend untersucht, wie sich das auf die Ökosysteme der betroffenen Gewässer ober- und unterhalb der Staumauern auswirken wird.
Seen als Wärmequelle
Eine bisher wenig genutzte Möglichkeit der Energiegewinnung besteht darin, den Seen im Winter Wärme zu entziehen und damit fossile Energieträger zu ersetzen. Gibt es Grenzen dieser Nutzung, zum Beispiel, weil sie sich negativ auf den See als Lebensraum auswirkt?
Die Wärme von Seen wird in der Schweiz zunehmend zum Heizen in Wärmeverbünden genutzt. Bei den größeren Schweizer Seen besteht dafür noch ein enormes Potenzial, welches genutzt werden kann, ohne dass negative Auswirkungen auf die Seeökologie zu erwarten sind. Ein weiterer Ausbau dieser regionalen und erneuerbaren Energiequelle ist deshalb sicher sinnvoll. Natürlich müssen dabei jeweils die möglichen Folgen für die Gewässer im Rahmen des Konzessionsverfahrens beurteilt werden. Einerseits sind dabei die lokalen Auswirkungen durch den Bau der benötigten Leitungen zu betrachten. Andererseits müssen mögliche Veränderungen der Temperatur und des Mischverhaltens der Seen, die sich durch Wärmeentnahme ergeben können, betrachtet werden.
Könnte man nicht auch die Flüsse oder das Grundwasser noch viel mehr als Wärmelieferanten nutzen?
Ja, die größeren Flüsse im Mittelland haben ebenfalls ein beträchtliches Potenzial für die Wärmenutzung. Hingegen sind sie je länger je weniger für Kühlnutzungen geeignet, da aufgrund des Klimawandels die Wassertemperaturen vielerorts immer häufiger über den Toleranzgrenzen mancher Arten liegen. Alpine Bäche sind wegen ihrer geringen Abflüsse und tiefen Temperaturen im Winter hingegen weniger für Heizzwecke geeignet.
Das Grundwasser wird heute bereits vielerorts als Wärmequelle genutzt. Dabei ist sicher darauf zu achten, dass sich langfristig keine zu großen Temperaturveränderungen ergeben, vor allem, wenn das Grundwasser auch für die Trinkwasserversorgung genutzt wird. Grundwasser kann auch als saisonaler Wärmespeicher interessant sein, welcher im Sommer zum Kühlen und im Winter zum Heizen genutzt wird.
Druck auf Wasserkraft
Karin Ingold, ist Eawag-Gruppenleiterin und Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern. Sie forscht über die Prozesse und Instrumente, mit denen die Schweiz Energiepolitik betreibt.
Aktuell ist der Druck sehr hoch, aus der Wasserkraft möglichst schnell noch mehr Energie zu gewinnen. Wie real ist dabei die Gefahr, dass demokratische Prozesse verletzt werden?
Karin Ingold: In der Schweiz gibt es genügend direktdemokratische und rechtliche Mittel, um sich Gehör zu verschaffen. Aber es ist eine Illusion zu denken, dass diese Mittel allen zur Verfügung stehen würden: Es braucht Ressourcen wie Wissen, Geld, Personal und auch Zeit, um solche Mittel “aktivieren” zu können.
Werden Landschafts- und Umweltschutz teilweise gegen die Energiewende ausgespielt?
Ja, das ist so. Aber ich bin überzeugt – und verschiedene Forschungsprojekte zeigen es – dass wir sogar in der kleinräumigen Schweiz genügend Platz hätten, um unsere Landschaften und natürlichen Ressourcen zu schützen und trotzdem erneuerbar zu werden. Dazu braucht es aber eine schweizweite Sicht darauf, wo Räume für die verschiedenen Ziele ausgeschieden werden.
“Politik der kleinen Schritte”
Müsste sich der Bund für eine schweizweite Sicht stärker von den Wünschen und “Gärtchen” der Kantone und Gemeinden lösen, um die Energiewende zu schaffen?
Durch unseren Föderalismus hätten wir das Potential, verschiedene Lösungen zu testen und die, welche von Erfolg gekrönt sind, weiter zu verbreiten. Dies braucht aber einen regen Austausch zwischen den Kantonen, und auch zwischen Kantonen, Gemeinden und dem Bund, über solche “best practices”. Dieser Dialog über alle Ebenen findet meines Erachtens noch zu wenig statt. Es kann sein, dass das Zeit braucht und es scheint, dass wir (zu) langsam vorwärtskommen. Aber die “Politik der kleinen Schritte” ist eine Schweizer Eigenheit. Sie steht eher für stetiges Lernen als für radikale politische Innovation.
Wie hoch ist in der Gesellschaft die Akzeptanz für die Energiewende und wie messen Sie das?
Soziale Akzeptanz hat viele Komponenten. Es gibt eine sehr hohe allgemeine Akzeptanz der Energiewende gegenüber. Gemessen wird das zum Beispiel im Sorgenbarometer der Credit Suisse oder regelmäßig an der Urne, wo das Volk ja das neue Energiepaket im Jahr 2017 deutlich angenommen hat.
Wenn es aber dann darum geht, sein Verhalten zu ändern, das Heizungssystem oder den privaten Transport umzustellen, dann sind diese Entscheide nicht nur von der Ideologie oder dem generellen Willen abhängig. Deshalb kann es durchaus eine Diskrepanz zwischen der individuellen Akzeptanz und der individuellen Verhaltensänderung, geben.
Das Interview wurde zuerst veröffentlicht von Eawag.