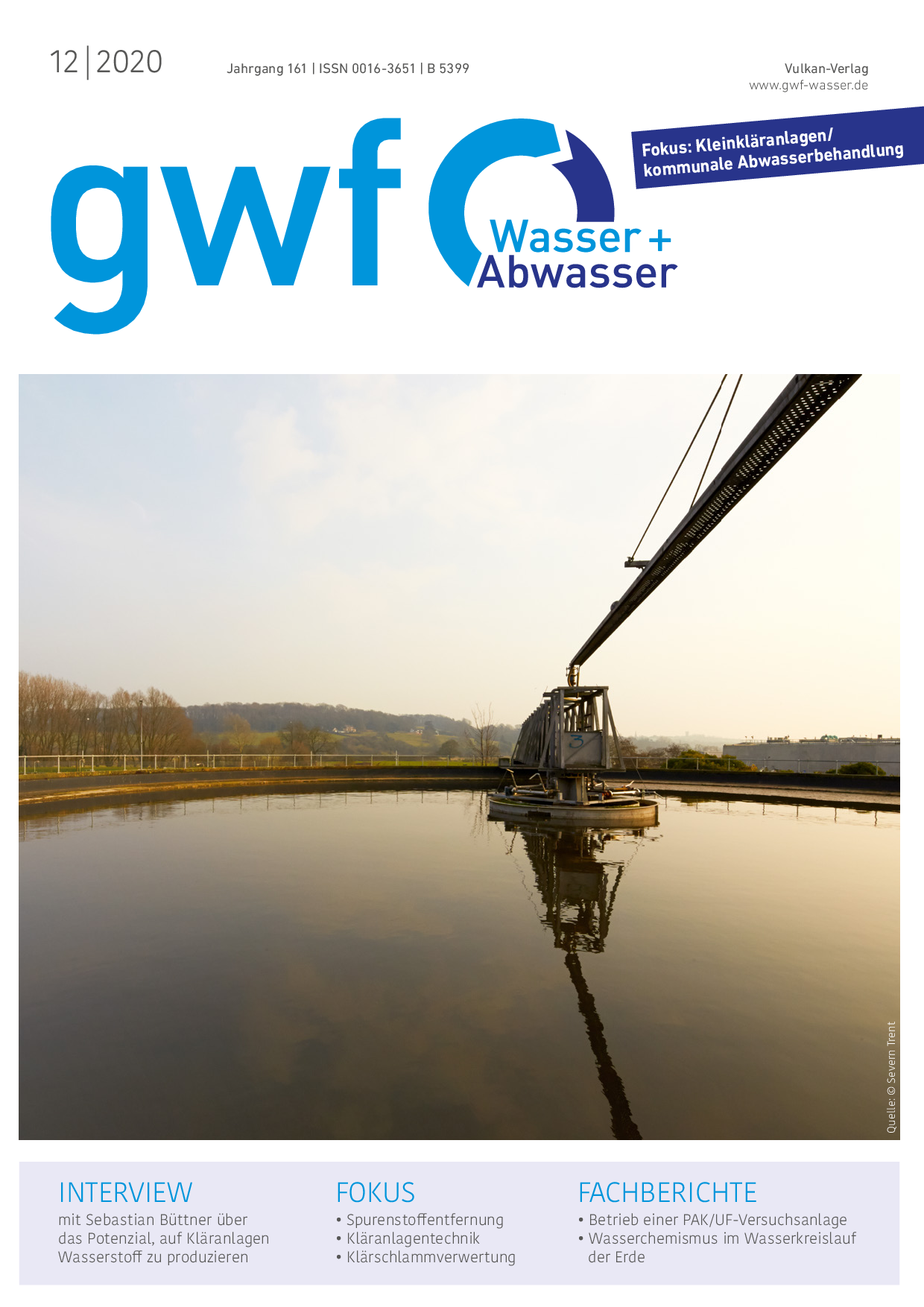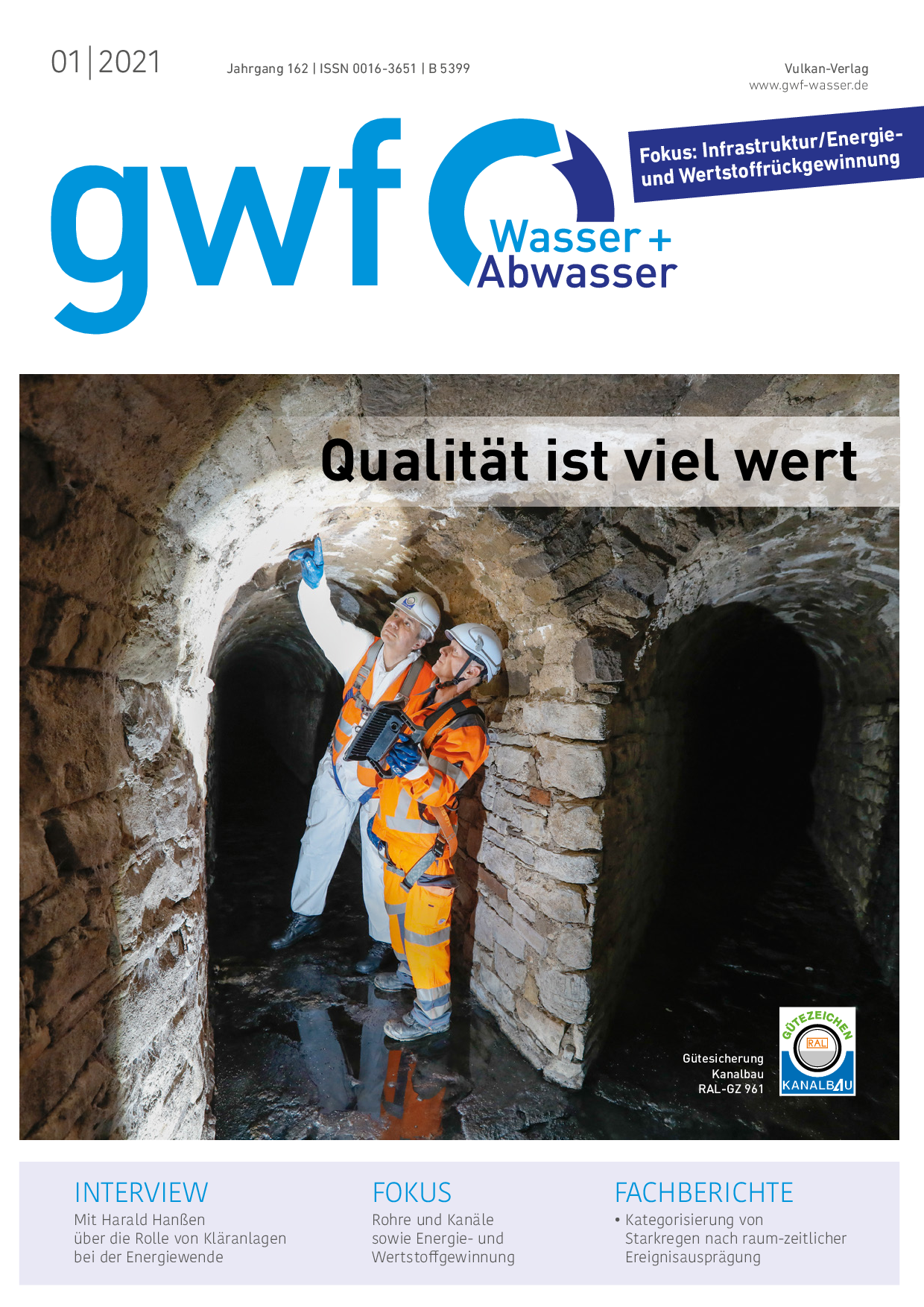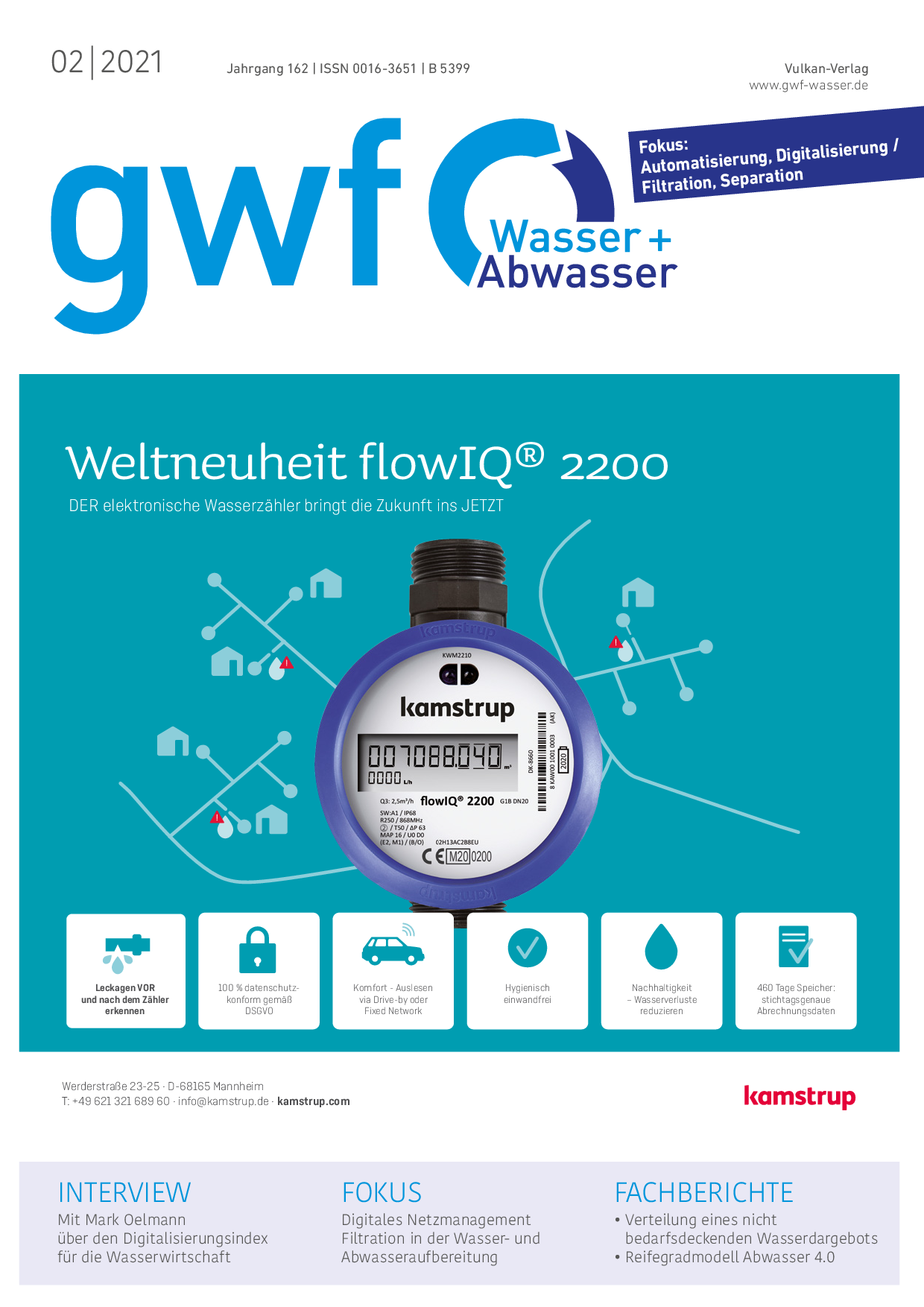Oktober 2022 | Von vulkanischen Seen können Gefahren ausgehen, die ein Monitoring ihres Zustandes notwendig machen. Vulkanische Seen können Speicher für vulkanische Gase wie Kohlenstoffdioxid oder Methan sein. So wie der Kratersee Kawah Ijen in Indonesien – auch bezeichnet als größtes Säurefass der Erde.
Der Kawah Ijen ist ein spezieller Fall unter den Vulkanseen. Denn täglich fließen große Mengen „blauer Lava“ in den See, die den Säuregehalt erhöhen. Als blaue Lava werden die Flüsse an über 500 °C heißem Schwefel bezeichnet, die die Hänge des Vulkans herunter fließen. Beim Austritt reagiert der Schwefel mit dem Sauerstoff in der Luft und entzündet sich.
Eine Reihe von lokal spürbaren vulkanisch-tektonischen Erdbeben, niederfrequente Erdbeben, starke Erschütterungen und ein Anstieg der Seetemperatur um 12 °C in den Jahren 2011 und 2012 gaben dem indonesischen Zentrum für Vulkanologie und geologische Gefahrenabwehr (CVGHM) Anlass zur Sorge. Das Zentrum bat das Volcano Disaster Assistance Program (VDAP) des U.S. Geological Survey, einen Workshop einzuberufen, um Empfehlungen zur Verbesserung der Überwachung und Vorhersage feuchter Vulkane zu erarbeiten.
Internationales Forscherteam untersucht Vulkan und Kratersee
|
Fakten zum Kawah Ijen |
|
| Lage | Insel Java, Indonesien |
| Typ | Stratovulkan (Schichtvulkan) |
| Letzte Eruption des Vulkans | 1999 |
| Tiefe des Sees | ca. 180 m |
| Gastemperatur der Fumarolen | 195 – 240° C |
| pH-Wert des Sees | 0,2 |
Daraufhin organisierten Wissenschaftler des VDAP zusammen mit Kollegen des CVGHM, des Königlichen Observatoriums von Belgien, des Earth Observatory von Singapur, GNS Science von Neuseeland und der McGill University von Kanada Mitte September 2014 einen internationalen Workshop am Kawah Ijen.
Die Teilnehmenden – 25 Wissenschaftler:innen aus 10 Ländern – untersuchten ein internationales Forscherteam den Vulkan samt See. Sie führten Messungen mit seismischen Breitband- und Infraschall-Arrays, thermischen Infrarotaufnahmen von Oberflächentemperaturen, differentieller optischer Absorptionsspektroskopie für Schwefeldioxid (SO2)-Emissionsraten, einer ultravioletten SO2-Kamera, Multigasdetektoren für die Echtzeitmessung mehrerer vulkanischer Gasspezies, neu entwickelter Diodenlaserspektroskopie für die Messung von atmosphärischem Kohlendioxid (CO2) und Proben von Fumarolgasen, saurem Wasser und Gipsablagerungen durch.
Die Workshop-Teilnehmenden diskutierten analoge Vulkane und Überwachungsmethoden sowie Interpretationen der magmatischen und hydrothermalen Prozesse, die für die Vorhersage von Ausbrüchen wichtig sind. Ein besonders nützliches Ergebnis war die Identifizierung des neuseeländischen Vulkans Ruapehu als “Schwestervulkan” des Kawah Ijen, der bemerkenswert ähnliche und gut untersuchte geologische Strukturen und geochemische/geophysikalische Prozesse aufweist. Da es keine modernen, überwachten Eruptionen gibt, helfen Informationen von analogen Vulkanen wie dem Ruapehu bei der Interpretation und Identifizierung von Vorläufersignalen, die zu eruptiven Ereignissen an anderen nassen Vulkanen führen.
Besondere Situationen der Vulkane erschweren Überwachung
Zu den Empfehlungen des Forscherteams zur Überwachung nasser Vulkane gehört die Festlegung einer Reihe von “Best Practice”-Techniken und geeigneter Instrumente für die routinemäßige Überwachung nasser Vulkane, wobei die besondere Situation jedes einzelnen Vulkans (z. B. die extrem saure Umgebung am Kawah Ijen) berücksichtigt werden sollte. Das internationale Team empfahl die Echtzeit-Überwachung von Gasen (insbesondere von CO2, das aufgrund seiner Nichtreaktivität in saurem Milieu frühzeitig vor Unruhen warnen kann) in Verbindung mit der herkömmlichen seismischen und geodätischen Echtzeit-Überwachung sowie die häufige Entnahme von Proben aus sauren Sickerquellen, die direkt mit aktiven hydrothermalen Systemen unterhalb des Vulkangebäudes verbunden sind.*
Schwefelabbau am Kawah Ijen unter gefährlichen Bedingungen

Der Schwefelabbau am Kawah Ijen findet unter gefährlichen Bedingungen statt. (Afandi Ahmad Syaikhu/Pixabay)
Der Kawah Ijen ist vor allem wegen des Schwefelabbaus bekannt. Im fast 300 m tiefen Krater befindet sich nicht nur der Säuresee, sondern auch ein mächtiges Fumarolenfeld. An den Fumarolen wurden Gastemperaturen zwischen 195 und 240 Grad Celsius gemessen. In extrem heißen Zeiten können die Gas-Temperaturen bis auf 600 Grad ansteigen. Dann steht der Vulkan kurz vor einem Ausbruch. Meistens sind die Temperaturen hoch genug, um den normalerweise flüssigen Schwefel zum Brennen zu bringen, so dass er regelmäßig gelöscht werden muss. Nachts sieht man diesen einzigartigen Schwefelbrand. Er manifestiert sich in saphierblauen Flammen. Werden sie nicht gelöscht, dann können sich kleine Feuerflüsse aus flüssigem Schwefel bilden, die bis in den Kratersee fließen.
Die Fumarolen fördern am Ijen täglich bis zu zehn Tonnen Schwefelgas. Die Gase werden durch ein Rohrsystem geleitet, das mit Wasser gekühlt wird. Aus dem Gas kondensiert flüssiger Schwefel, der unterhalb von 115 Grad fest wird. So lagert sich der Schwefel am Ende der Rohre in mächtigen Schichten ab. Der Abbau des Schwefels erfolgt dann auf einfachste Weise: Die Minenarbeiter brechen ihn mit Eisenstangen heraus und tragen ihn in Körben aus dem Krater – bis zur drei Kilometer entfernten Verladestation. Dort wird der Schwefel gewogen und verladen. Pro Ladung fördern die Schwefelarbeiter bis zu 70 kg Schwefel für den sie ca. 2,50 Euro bekommen. Mit viel Glück schaffen sie 2 Fuhren pro Tag.
Doch der Ijen ist ein gefährlicher Vulkan: immer wieder kommt es zu phreatischen Eruptionen aus dem Grund des Säuresees. 1976 starben bei einer solchen Eruption 49 Schwefelarbeiter. Zudem schädigen die ätzenden Dämpfe am See die Lungen der Minenarbeiter.**
* Gunawan, H., J. Pallister, and C. Caudron (2014), Multidisciplinary monitoring experiments at Kawah Ijen Volcano, Eos Trans. AGU, 95(48), 447–448, doi:10.1002/2014EO480003.
** Kawah Ijen und der Schwefel: https://www.vulkane.net/vulkane/kawah-ijen/kawah-ijen.html