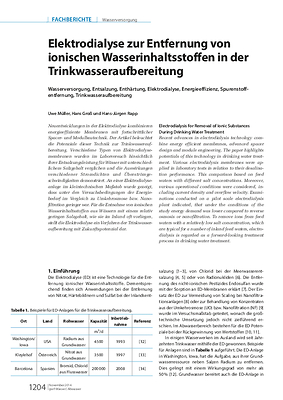Aktualisiert 23.01.2017 15:30 Uhr
Die Novelle der Klärschlammverordnung, wie sie das Bundeskabinett jetzt verabschiedete, würde dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) zufolge die Kommunen erheblich belasten: „Zum einen, weil entsprechende Verbrennungskapazitäten und Aschelager geschaffen werden müssten. Zum anderen, weil man auch weitere Untersuchungen zur Phosphorrückgewinnung durchführen müsste.“ Für den VKU gilt: Klärschlamm ist nicht gleich Klärschlamm. Er fordert daher, die Neuregelung der Klärschlammverwertung an der Qualität der Klärschlämme auszurichten. Die Koalition bevorzuge dagegen den Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlämmen, unabhängig von der Qualitätsfrage.
„Schwellenwerte akzeptabel“
Was die ebenfalls vorgesehene verpflichtende Phosphorrückgewinnung angeht, seien die aktuellen Schwellenwerte – Kläranlagen, die Abwässer für 100.000 bzw. 50.000 Einwohnerwerte entsorgen – und die Umsetzungsfristen von 12 beziehungsweise 15 Jahren aus Sicht der kommunalen Abwasserentsorger ein akzeptabler Kompromiss. „Allerdings darf es zu keinen weiteren Verschärfungen kommen“, betont der VKU. Zudem solle die vorgesehene Pflicht zur Phosphorrückgewinnung nur dann umgesetzt werden, wenn es auch wirtschaftlich vertretbare Verfahren gibt. Das sei derzeit nicht der Fall.
VKU fordert Förderprogramme
Wegen der befürchteten Investitionskosten fordert der Verband Bund und Länder zur Unterstützung durch Förderprogramme auf. Zudem müsse die Gebührenfähigkeit der mit der Umsetzung verbundenen Maßnahmen sichergestellt werden.
„Vernünftiger Kompromiss“
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) dagegen sieht in der Klärschlammnovelle einen vernünftigen Kompromiss: „Der BDEW begrüßt, dass die Verordnungsinhalte im Rahmen der politischen Debatte praktikabel gestaltet wurden“, so Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser. „Dazu zählen insbesondere die längeren Übergangsfristen für den Bau von Klärschlammverbrennungs- und Phosphor-Rückgewinnungsanlagen.“ Angesichts der Planungs- und Genehmigungszeiträume für die Errichtung von Anlagen zur Phosphor-Rückgewinnung seien die für größere Kläranlagen vorgeschlagenen Fristen von 12 beziehungsweise 15 Jahren zur verpflichtenden Einführung realistisch, so Weyand weiter. Bisher ist die Phosphor-Rückgewinnung noch nicht großtechnisch umsetzbar.
„Mitverbrennung nicht einschränken“
Bedauerlich sei, dass die Novelle mit sachlich nicht gerechtfertigten Vorgaben zu einem sehr niedrigen Aschegehalt der Kohle die Klärschlamm-Mitverbrennung beschränke. Eine solche Vorfestlegung auf bestimmte Brennstoffeigenschaften sei im Hinblick auf die laufende Entwicklung von großtechnisch einsetzbaren Verfahren zur Phosphorrückgewinnung aus Mitverbrennungsaschen nicht erforderlich.
„Qualität sollte ausschlaggebend sein“
Handlungsbedarf sieht der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE). Das angestrebte Verbot der bodenbezogenen Klärschlammverwertung sei ein Irrweg: „Klärschlämme allein wegen der Größe der Behandlungsanlagen als Düngemittel zu verbieten, hat fachlich keinen Sinn. Stattdessen sollte die Qualität des Klärschlamms ausschlaggebend sein“, sagte BDE-Präsident Peter Kurt. Im Sinne des Ressourcenschutzes sei es zielführender, Phosphor aus Klärschlämmen zurückzugewinnen, die qualitativ nicht hochwertig genug sind, um bodenbezogen verwertet zu werden: „Schon heute werden 60 Prozent des Klärschlamms verbrannt, ohne dass hieraus Phosphor zurückgewonnen wird. Aus Klärschlämmen niedriger Qualität sollte Phosphor besser zurückgewonnen werden und Schlämmen hoher Qualität sollten weiterhin zur direkten Düngung zugelassen werden“, so Kurth weiter.