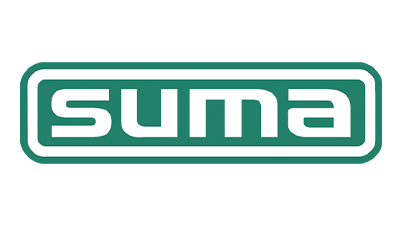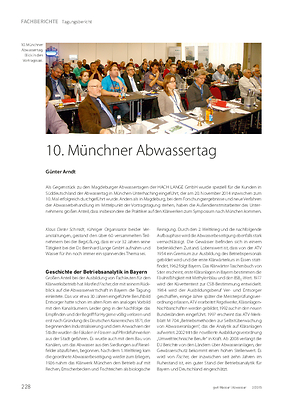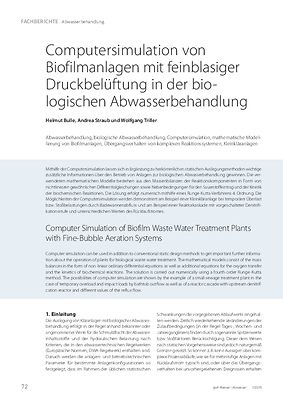Wie kann man das für die Landwirtschaft und die menschliche Ernährung unverzichtbare Element Phosphor aus Klärschlamm wiederverwerten? Wie lassen sich Kohlenstoff und Wasserstoff aus diesem Abfallprodukt zurückgewinnen? Das sind die beiden zentralen Fragen, die RWE Power und ihre Forschungspartner Ruhr-Universität Bochum (RUB) und das Fraunhofer UMSICHT jetzt im RWE Innovationszentrum am Standort Niederaußem beantworten wollen. Dort ist heute eine Forschungsanlage in Betrieb gegangen: Die Multi-Fuel-Conversion-Anlage (MFC) soll zum einen Phosphor aus dem Klärschlamm zurückgewinnen und zum anderen Klärschlamm und andere Brennstoffe in Synthesegas umwandeln, eine wichtige Quelle für Kohlenstoff und Wasserstoff in der chemischen Industrie. Im bevölkerungsreichsten Bundesland fallen weiterhin große Mengen an Klärschlamm an. Der darin gebundene und nur begrenzt in der Natur vorkommende Rohstoff Phosphor wird bislang nicht genutzt. Ab 2029 ist das Recycling von Phosphor in Deutschland verpflichtend.
Von gasförmigem Phosphor zu Phosphorsäure
In der Anlage werden Gemische von Klärschlamm, Klärschlamm-Asche und Braunkohle hohen Temperaturen um 1.500 Grad Celsius und starkem Sauerstoffmangel ausgesetzt. Auf diese Weise soll gasförmiger Phosphor freigesetzt werden, der – möglichst rein abgeschieden – zu Phosphorsäure verarbeitet werden kann. »RWE Power hat viel Erfahrung mit Techniken zur Umwandlung fester Brennstoffe zu gasförmigen Stoffgemischen, die sich hervorragend für die Produktion von Chemiegrundstoffen eignen. Mit unseren Partnern entwickeln wir sie in unserem Innovationszentrum weiter. Zudem tragen wir dazu bei, dass auch die ökonomischen, ökologischen und sozialen Elemente einer kreislauforientierten Kohlenstoffwirtschaft fachübergreifend erforscht werden. Das ist Wissenschaft in Theorie und Praxis – nachhaltig und auf viele Jahre angelegt«, hob RWE Vorstand Lars Kulik hervor.
Testbetrieb gestartet
Christoph Dammermann, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Bergheims Bürgermeister Volker Mießeler, Prof. Eckhard Weidner von der Ruhr-Uni Bochum und dem Fraunhofer UMSICHT starteten gemeinsam mit RWE Power-Vorstand Dr. Lars Kulik und Forschungsleiter Tilman Bechthold den Testbetrieb. Kosten: 6,7 Millionen Euro.
Das Projekt ist Teil des virtuellen »Innovations- und Technologiezentrums zur stofflichen Nutzung nachhaltiger Kohlenstoffquellen« (ITZ-CC), einem Kooperationsprojekt von RWE, Fraunhofer UMSICHT und Ruhr-Universität Bochum. Gefördert wird das ITZ-CC durch das Wirtschaftsministerium.
Kreislaufwirtschaft voranbringen
Staatssekretär Dammermann: »Das Rheinische Revier ist auf einem guten Weg, seine Bedeutung für den Forschungsstandort Nordrhein-Westfalen auszubauen: Mit innovativen Projekten wie der neuen Multi-Fuel-Conversion-Anlage in Niederaußem oder dem Brainergy-Park in Jülich gestalten wir den Strukturwandel und gehen gemeinsam die Herausforderungen des Klimawandels an. Das Vorhaben in Niederaußem hat großes Potenzial, die Kreislaufwirtschaft in unserem Land weiter voranzubringen.«
»Es ist gut, dass hier am Kraftwerksstandort Niederaußem weiter an so wichtigen, zukunftsorientierten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Kohlenstoffkonversion und -nutzung gearbeitet wird«, freute sich Bergheims Bürgermeister Volker Mießeler.
Kohlenstoff-Rückgewinnung
Prof. Eckhard Weidner von RUB/Fraunhofer betonte den zweiten großen Aspekt des MFC-Projekts: die Kohlenstoff-Rückgewinnung. »Die Industriegesellschaften verabschieden sich von der Kohle, nicht aber vom chemischen Element Kohlenstoff, das unverzichtbar bleibt. Deshalb ist es für sie essenziell, technische Kohlenstoff-Kreisläufe zu erforschen, Kohlenstoff aus unterschiedlichen Quellen klimafreundlich zu erschließen und somit nachhaltige Konversionstechnologien zu entwickeln. Das MFC ist ein wichtiger Baustein in dieser globalen Forschung«, so der Wissenschaftler. Im Rahmen des MFC-Verfahrens entsteht Synthesegas, eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Es kann als Rohstoff für die Produktion von Wasserstoff, aber auch von Methanol, Methan, Kunststoffen, Treibstoffen und weiteren Einsatzstoffen für die chemische Industrie eingesetzt werden.
RWE ist seit über 25 Jahren in der thermischen Verwertung von Klärschlamm engagiert. Die im vergangenen Jahr verwerteten rund 900.000 Tonnen entsprechen rund der Hälfte des Aufkommens in NRW. »Die MFC-Technologie ist ein vielversprechender Weg, nicht nur Klärschlamm zu entsorgen, sondern gleichzeitig wertvolle Bestandteile daraus zurückzugewinnen – ein Gewinn für die Umwelt und für unsere kommunalen Kunden wie die Wasserverbände in NRW«, nannte Tilman Bechthold, Leiter Forschung und Entwicklung bei RWE Power die Vorzüge.