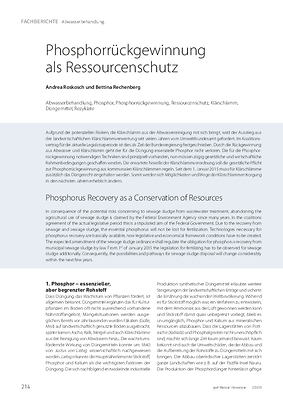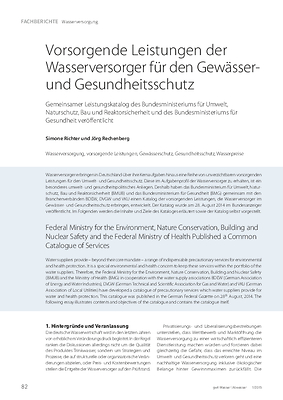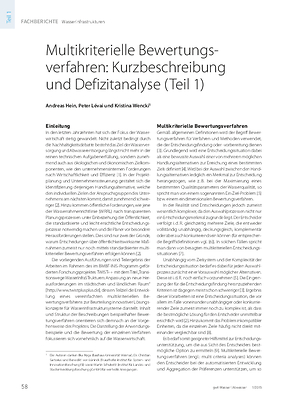Quecksilber, das hauptsächlich von Kohleverbrennungsanlagen emittiert wird, trägt dazu bei, dass Gewässer in der EU keinen guten chemischen Zustand erreichen. Die EU-Mitgliedstaaten haben keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen und laufen Gefahr, gegen das EU-Wasserrecht zu verstoßen, das einen schrittweisen Ausstieg aus den Quecksilberemissionen vorschreibt, wie in einem neuen Briefing des Europäischen Umweltbüros dargelegt wird. Ein Ausstieg aus der Kohleverbrennung bis 2027 sei erforderlich, um die Verpflichtungen hinsichtlich der Quecksilber-Grenzwerte zu erfüllen.
Ein giftiges Schwermetall
Quecksilber ist ein Schadstoff, der für lebende Organismen, einschließlich des Menschen, hochgiftig ist. Die Verbrennung von Kohle ist die Hauptquelle für Quecksilber in der Luft in der EU und macht etwa 60 % der Emissionen aus.
Nur zehn Kohleverbrennungsanlagen in Bulgarien, der Tschechischen Republik, Deutschland (basierend auf Daten für 2017) und Polen emittierten 2019 7,6 Tonnen Quecksilber, mehr als doppelt so viel wie die Emissionen von Frankreich, Griechenland und Spanien zusammen.
Einmal emittiert, verbleibt Quecksilber in der Atmosphäre, verteilt sich weiträumig und liegt in verschiedenen chemischen Formen vor. Durch natürliche Prozesse kann es in eine besonders giftige organische Form namens Methylquecksilber umgewandelt werden.
Quecksilber reichert sich in lebenden Organismen an und wird durch einen Prozess, der als Bioakkumulation bezeichnet wird, in der höheren Nahrungskette immer stärker konzentriert. Dieser Prozess stellt das größte Expositionsrisiko für den Menschen dar: durch die Aufnahme von quecksilberhaltigen Lebensmitteln.
Es gibt kein sicheres Niveau der Quecksilberexposition, und es ist besonders gefährlich für Föten und Kleinkinder, da die Exposition neurologische Schäden verursacht, die Gehirnentwicklung verlangsamt und die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Der Schadstoff wirkt sich auch auf das Herz-Kreislauf-System, die Nieren, die Leber und die Lunge aus.
Quecksilber im Wasser
Die atmosphärische Ablagerung von Quecksilber ist der Grund dafür, dass mehr als 45 000 bzw. 30 % der Wasserkörper in der EU den in der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) festgelegten guten chemischen Zustand nicht erreichen. Diese Richtlinie ist das wichtigste Rechtsinstrument der EU, mit dem der gute Zustand aller EU-Gewässer entweder bis 2015 oder spätestens bis 2027 erreicht werden soll. Trotz der Verabschiedung der Richtlinie vor 20 Jahren befinden sich 40 % der Wasserkörper in einem schlechten chemischen Zustand, da sie übermäßige Konzentrationen von so genannten prioritären gefährlichen Stoffen aufweisen.
Quecksilber ist als einer dieser prioritären gefährlichen Stoffe definiert, was bedeutet, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Maßnahmen zu ergreifen, um Quecksilberemissionen zu unterbinden. Die Wasserschutzbehörden haben die Quecksilberverschmutzung in den Bewirtschaftungsplänen für die Flusseinzugsgebiete, den wichtigsten Instrumenten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, bisher nicht berücksichtigt.
Gefährdung der Umwelt
Quecksilberemissionen fallen auch unter eine andere verbindliche EU-Rechtsvorschrift, nämlich die Richtlinie über Industrieemissionen, die darauf abzielt, schädliche Emissionen aus der Industrie zu verringern. Diese Richtlinie schreibt strengere Genehmigungsbedingungen für Emissionen vor, wenn die Umweltnormen nicht eingehalten werden.
Die Aussteller von Genehmigungen passen ihre Emissionsgrenzwerte jedoch an die mildesten Normen der Richtlinie an, was dazu führt, dass in den meisten Fällen bei den Quecksilberemissionen alles beim Alten bleibt. In der Zwischenzeit sind gemäß der Richtlinie in begrenzten und spezifischen Fällen Ausnahmen für die Festlegung weniger strenger Emissionswerte zulässig, doch in der Praxis haben die Mitgliedstaaten von diesen Ausnahmeregelungen ausgiebig Gebrauch gemacht.
“Dieser Rechtsakt zielt darauf ab, die Umwelt insgesamt zu schützen, indem die Verschmutzung an der Quelle verhindert wird. Wenn also Genehmigungen erteilt werden, muss dies im Sinne dieser Ziele geschehen. Doch immer wieder werden Genehmigungen erteilt, die diesen Schutzzielen völlig zuwiderlaufen und die Umwelt direkt gefährden. Wir müssen damit beginnen, die Richtlinie über Industrieemissionen so anzuwenden, wie sie gedacht war: zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt”, sagte Bellinda Bartolucci, Juristin bei der Umweltrechtsorganisation ClientEarth.
Die Umsetzung der strengeren Emissionsstandards, die in der Richtlinie über Industrieemissionen festgelegt sind, sowie der in den Leitlinien für die Kohleverbrennung im Rahmen des Minimata-Übereinkommens empfohlenen Standards würde die Quecksilberemissionen erheblich reduzieren – aber auch bei Anwendung der strengsten Standards wird bei der Kohleverbrennung weiterhin Quecksilber freigesetzt.
Kohle bis 2027 gegen Wasser tauschen?
Um der Verpflichtung zum schrittweisen Ausstieg aus der Quecksilberverbrennung nachzukommen und um das Ziel der Richtlinie, einen guten chemischen Zustand der EU-Gewässer zu erreichen, zu erfüllen, müssten die Mitgliedstaaten die Kohleverbrennung bis spätestens Ende 2027 einstellen.
Die bevorstehende Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften für Quecksilber im Rahmen des europäischen Green Deal für eine giftfreie Umwelt bietet die Möglichkeit, die Quecksilberverschmutzung weiter zu verringern. Neben dem Verbot der Verbrennung stark quecksilberhaltiger Brennstoffe wären strenge Grenzwerte für die Verschmutzung anderer Quellen von Quecksilberemissionen erforderlich, etwa für die Herstellung von Zement, Eisen, Stahl und Nichteisenmetallen.
Die Europäische Kommission sollte auch keine staatlichen Beihilfen für Kohleverbrennungsanlagen genehmigen, die nach 2027 stillgelegt werden, da dies eine Finanzierung der fortgesetzten Quecksilberemissionen bedeuten würde.
“Quecksilber ist einer der Hauptgründe für den schlechten chemischen Zustand der europäischen Flüsse und Seen. Doch anstatt Maßnahmen gegen die größten Emittenten zu ergreifen, erlauben Länder wie Deutschland, die Tschechische Republik und Bulgarien großen Kohlekraftwerken, über die EU-Normen hinaus zu emittieren, und ignorieren dabei die Tatsache, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um Europas Gewässer bis 2027 wieder in einen guten Zustand zu versetzen”, sagte Sara Johansson, Politikberaterin und Forscherin für Industrieproduktion beim Europäischen Umweltbüro.
Die europäischen Länder standen bereits unter dem Druck, bis spätestens 2030 aus der Kohle auszusteigen, um dem Pariser UN-Klimaabkommen zu entsprechen, aber mehrere werden das Ziel der Wasserrahmenrichtlinie für 2027 nach ihren derzeitigen Plänen nicht erreichen.
Dänemark, Finnland, Deutschland, die Niederlande, die Slowakei und Spanien streben einen Ausstieg nach 2027, aber bis 2030 an, während Bulgarien, Kroatien und Rumänien einen Ausstieg für die Zeit nach 2030 angekündigt haben. Für die Tschechische Republik und Slowenien wird der Ausstieg noch diskutiert, und Polen hält an seinem weit entfernten Ziel für 2049 fest.
(Quelle: EEB – European Environment Bureau)